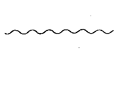|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Guten Morgen, Erlaucht!« klang es von hüben und drüben, wenn der Gutsherr im schlichten Jagdkostüm, das Gewehr über die Schulter gehängt, in Begleitung seines zehnjährigen Söhnleins durch Wiesen und Felder schritt, um seine Morgenpfeife im Freien zu rauchen und wohl auch ein wenig nach den Leuten zu sehen. Männer, Frauen, Knechte und Mägde hielten dann in der Arbeit inne, senkten Rechen oder Hacke und erwarteten des Herrn Gegengruß, denn ohne einen solchen schritt er nicht vorüber; und zwar bestand derselbe nicht in freundlichem Nicken, sondern in Worten, denen sich das Herz aufschloß und alles zu tage kam, was darauf lastete. Der Graf war in alle Familienverhältnisse eingeweiht. Unter seinen Unterthanen aufgewachsen, kannte er die Jungen und Alten mit Namen; er wußte, wo jeden »der Schuh drückte« und verwendete bereitwillig Rat und That als »Leisten«, um ihn auszuweiten. Die offene Flur war gleichsam sein »Vorzimmer«, woselbst er jedem Audienz gab, und diese Spaziergänge mit Raimund wurden zu Lektionen für den Knaben, damit dieser dereinst in gleichem Geiste das väterliche Erbe verwalte.
»Guten Morgen! wie geht's daheim?« klang es von des Grafen Mund; der Angeredete strich sich das Haar aus der Stirne und erwiderte mit einiger Befangenheit:
»So weit schon gut, Erlaucht! Danke gehorsamst für die gnädige Nachfrag. Das Weib wär' gesund, und der kleine Bub schreit aus Leibeskäften, aber –«
»Nun, frisch heraus mit der Sprach! was soll's mit dem ›aber‹?« ermunterte der Graf.
Der Angeredete faßte Mut und sagte: »Nun, Euer Erlaucht, es wär halt wegen der Tauf'. Eine Johanna hätten wir freilich nach dem Namen, der seligen Frau Gräfin, und jetzt möchten wir halt gar so gern einen Fritz.«
Da lachte der Graf und entgegnete: »Muß doch einmal den Pfarrer fragen, wie viele ›Friedrich‹ jetzt schon im Taufbuch stehen.«
»Das wär just nach der Häuserzahl zu berechnen, Euer Erlaucht. Es gibt, gottlob! fast überall einen Buben, und wir haben keinen Namen lieber, als den von unserm Herrn Grafen. Es ist gar ein leutseliger und guter, unser Herr! Gott erhalt ihn und den jungen Herrn und geb der seligen Frau Gräfin die ewige Ruh!« –
Da schwieg der Graf eine Weile, stocherte in seiner Pfeife und verbarg seine Rührung hinter dicken Rauchwolken; dann sagte er mit freundlichem Tone:
»Wann soll die Taufe sein?«
»Mit gnädigem Verlaub, morgen; Euer Erlaucht und der Schloßgärtner wär gewiß so gut –«
»Komm schon selber in die Kirch und bring meinen Raimund mit; den geht der junge Nachwuchs mehr an als mich; er kann ihn nicht früh genug kennen lernen. Und jetzt, guten Morgen! – Einen Gruß an Euer Weib und an's Hannele.«
Weiter schritt der Graf; der Mann schaute ihm eine Weile nach und sagte, wie im Gebete, vor sich hin: »Gott segne ihn, und schenk ihm ein langes Leben, wie seinen Vorfahren. Es ist ein Herr, wie's gewiß keinen zweiten gibt, weit und breit.«
Ja, ein guter Herr war der »alte Graf«, wie ihn die Leute zum Unterschied von dem »jungen« nannten, obwohl er kaum das fünfzigste Lebensjahr überschritten hatte. Er gewährte das Musterbild eines hochadeligen Gutsherrn – vornehm im ganzen Wesen trotz seiner schlichten Kleidung und Redeweise, welche sich dem Verständnisse der Landleute anpaßte. Er setzte sich niemals einer bäurischen Vertraulichkeit aus und besaß doch das allgemeinste Vertrauen. Alle liebten ihn, und der fünfte März war ein Freudenfest für alle; auch gab es ja beinahe in jedem Hause einen »Fritz«, denn die eben erzählte Szene wiederholte sich nicht selten. Morgens kam die große Schar seiner Taufpaten in den Schloßhof zur Gratulation, und wohl auch, um den eigenen Namenstagsthaler zu empfangen. Nachmittags versammelten sich seine Unterthanen auf einem großen Waldplatze zum Festschießen. Kam dann der Graf mit Raimund angefahren, so erhob sich endloser Jubel, und gelang ihm ein Meisterschuß, so stieg der Jubel aufs höchste; – den Preis überließ er ja stets dem zweitbesten Schützen. Da wurde manches Faß Märzenbier aus dem gräflichen Brauhause geleert und »Hoch!« um »Hoch!« schallte durch die grünen Zweige.
Es war ein ziemlich umfangreicher Landstrich, der dem Grafen angehörte. Wenn er im Turmerker des Schlosses auf der Bergeshöhe hinausschaute auf den Strom, das herrliche Wiesengrün, die wogenden Aehrenfelder, die kleinen, vielzähligen Ortschaften und die dunkle Waldgrenze, konnte er sich sagen: »Das ist alles mein Eigentum, und sie lieben mich, die guten Leute.«
Ja, sie liebten ihn, er hatte teil genommen an ihren Freuden und Leiden, und sie gleichfalls an den seinigen. Sie hatten mit ihm die Hochzeit, die Tauffeste gefeiert, und sie waren mit ihm zur Familiengruft gefolgt, als er die freundliche Gattin dorthin geleitete; sie vergossen herbe Thränen mit ihm und hielten eine echte Familientrauer.
An dem Erbgrafen Raimund hingen die treuen Herzen alle; nur eines schmerzte sie fast, daß er nicht den Namen seines Vaters trug; er klang so fremd, aber der Knabe wurde ihnen bald vertraut genug und damit auch der Name. Wenn Raimund in des Vaters Begleitung da und dort freundliche Einkehr hielt, hatte die Bäuerin stets goldgelben Honig in Bereitschaft, und die morgens gerührte Butter wollte ihr schon als alt erscheinen. Wie oft war der kleine Knabe bei ihren Wanderungen über die Aecker von dem Vater auf den Gaul vor dem Pfluge gesetzt worden! Dann hatte es das Rößlein mehrere Tage doppelt gut; der Bauer strich ihm und sich selbst die Haare über die Stirne und war nicht wenig stolz auf diese Ehre. Wenn aber Raimund auf der Wiese den Drachen steigen ließ, dann eilten aus Häusern und Hütten die Kinder herbei, und nicht selten stand der junge Graf in ihren Reihen beim muntern Spiele. Raimund hatte von seinem Vater jene feine Lebensart gelernt, mit welcher man geschützt ist vor jeder Gemeinheit. Niemals brachte er eine Unart aus dem Kreise der Dorfknaben nach Hause; aber diese lernten von ihm Gesittung, und es klang oft recht komisch, wenn die Bauernkinder sich in hochdeutschen Redensarten zu Ehren der vornehmen Gesellschaft versuchten.
Raimund verlebte auf diese Weise frohe Jahre der Kindheit. Obgleich der einzige Sohn, fühlte er sich niemals einsam. Wie fröhlich schlug sein Herz, wenn ein Bursche den blau- und gelbgestreiften Kahn vom Schifferhäuschen losband, den jungen Herrn auf dem Flusse dahinruderte und ein Liedchen sang; oder wenn der Förster ihm die Jagdbeute zeigte, schillernde Federchen auf das graue Hütchen steckte, oder ihn gar einen Schuß abdrücken ließ; wenn der »Schweizer« für ihn ein eigenes Käselaibchen bereitete, die Dorfknaben ihre jungen, weißen Kaninchen, ein lieblich singendes Vögelchen, und die Bäuerinnen ihre Kirchweihnudeln brachten. So entschwand Raimund die Kindheit, und so festigte sich schon frühzeitig das Band, welches ihn mit den künftigen Unterthanen vereinte.
Der Graf wußte wohl, daß all die schönen Besitzungen für seinen Raimund nur glückbringend würden, wenn er ihm zugleich eine gute Erziehung gäbe; er bedachte auch, daß alle seine Güte und Sorgfalt für seine Untergebenen, ohne ihnen zugleich die Güte und Sorgfalt seines Nachfolgers gesichert zu haben, nur eine halbgethane Sache sei. Tag und Nacht beschäftigte ihn diese Angelegenheit; denn es war höchste Zeit, es mußte für Raimund ein Erzieher ausgesucht werden. Der Graf verkannte die Schwierigkeit nicht, den rechten Mann dafür zu finden; vor allem mußte er einen verständigen, liebevollen Mann aussuchen, der in des Grafen bisheriger Art fortwirkte und damit die nötigen Kenntnisse verbinde. Endlich gelangte er zum Ziele. Unter denjenigen, welche sich persönlich meldeten, wählte er einen jungen Mann, zu dem er sich gleich beim ersten Blicke hingezogen fühlte. Herr Helbing hatte einen gar offenen, heitern Gesichtsausdruck; die Seele blickte ihm aus den Augen, und der Geist, mit Ernst gepaart, stand auf seiner Stirne zu lesen. Dabei hatte er gebildete, aber einfache Manieren und einen wohlklingenden Ton der Stimme, der zum Herzen sprach. Vor allem entwarf ihm der Graf ein getreues Bild von seinem Sohn. Er schilderte ebenso ausführlich dessen schlimme, wie gute Anlagen. Helbing sah also mit wahrhaft »väterlichen Augen« in die Seele seines Zöglings, und es kam nur noch darauf an, daß auch Raimund kindliches Vertrauen und kindliche Liebe zu ihm gewann.
Der junge Graf hatte sich bisher frei von großem Lernzwange bewegt. Die Aussicht auf eine Aenderung dieser Lebensweise kam ihm keineswegs erfreulich vor; er sah deshalb dem Hofmeister mit Bangen entgegen und dachte: »O weh! nun ist's vorbei mit aller Lustigkeit! nun heißt's: studieren und nichts als studieren, bis mir's schwindelt vor lauter studieren.« –
In seiner Mißstimmung hatte er den Drachen verdorben und, was am schwersten zu reparieren war, die künstliche Mechanik in seinem Schifflein, welches, mit einem Schlüssel aufgezogen, so emsig auf dem ruhigen, unbewegten See unweit des Schlosses dahinschwamm. »Daran ist niemand schuld, als der alte Hofmeister!« murrte er innerlich und bildete sich von demselben eine eben nicht schmeichelhafte Vorstellung. Mitten darin hörte er einen Wagen in den Hof rollen, der Gefürchtete war angekommen, und bald darauf trat derselbe mit dem Grafen in das Zimmer. Kaum hatte die gegenseitige Begrüßung stattgefunden, als sich Raimund auch schon wieder seinem Schifflein zuwandte und mit einer Zange daran arbeitete. Er bemerkte gar nicht, daß Helbing betrachtend daneben stand, bis er endlich die Worte vernahm: »So geht's nicht, die Zange ist zu groß. Warte ein wenig, ich will mein Instrument holen, ich hab es nah zur Hand, im Reisesack.«
Verblüfft sah Raimund dem Hofmeister nach und war damit noch nicht einmal zu Ende, als derselbe auch schon wieder zurückkehrte und sprach:
»Laß einmal sehen, Raimund. Mein kleiner Bruder hat gerad solch ein Schifflein, das ich oftmals wieder flott machte.«
Sogleich steckten die beiden ihre Köpfe zusammen; Raimund deutete auf das Hemmnis, Helbing erklärte ihm die Mechanik. Es war nichts zerbrochen, sondern nur verschoben, und bald lief das Rädlein wieder prächtig ab. Nun holte Raimund auch seinen Drachen herbei. Diesem fehlte weit mehr, und es vergingen ein paar Stunden bei der Reparatur. Aber es fehlte noch eine geraume Zeit bis zum Abendessen; der Versuch, ob alles wirklich in Ordnung sei, konnte noch angestellt werden. Die beiden eilten ins Freie; Raimund diente als erklärender Führer und zeigte dem Neuangekommenen mit etwas Stolz die schöne Heimat, über welcher sich der reinste, blaue Himmel wölbte und die Strahlen der Abendsonne Feld und Au vergoldeten. Wie der vom Abendhauche etwas bewegte See glitzerte, und wie lieblich die Vögel sangen!
Das Schifflein schwamm, und der Drache stieg; der Hofmeister und Zögling aber waren dabei bereits »gut Freund« geworden. Nach dem Abendessen ging Helbing in sein Zimmer, um auszupacken; Raimund blieb beim Grafen und sagte:
»O, Papa, Herr Helbing ist gar nicht übel, fast so heiter, wie du, und gar kein alter, strenger Herr, wie ich ihn mir vorstellte. Er kann auch allerlei; o, ich meine nicht nur Lateinisch, Griechisch und wie die alten Sachen heißen; weißt du, andere Dinge, drechseln und hämmern; er kann auch schießen, schwimmen und reiten. Ich hab ihn ausgefragt, und er hat mir's zugestanden; er wird mich alles lehren. Nun wird's erst recht lustig werden, Papa!«
Der Unterricht begann und dabei war's Ernst, kein Spiel. Dies sagte auch der Hofmeister seinem Zöglinge: »Es ist Lebensernst, Raimund! Das Lernen macht das Kind zum Knaben, den Knaben zum jungen Mann! Du siehst also, wie das Lernen dich stufenweise emporführt, und hoffentlich wirst du auch ein gescheiter Mann werden wollen, vor dem die Unterthanen Respekt haben, wie vor deinem Vater! Drum frisch daran! nach vollendeter Arbeit wollen wir um so freier und lustiger hinauseilen und den Drachen bis zu den Wolken steigen lassen. Zuerst aber empor, empor mit dem Geiste!«
Das ermutigte den jungen Grafen, und er lernte mit wahrem Eifer; es hatte für ihn einen starken Reiz, sich durch Schweres hindurchzuarbeiten und täglich vorwärtszukommen, wie es einer kräftigen, edlen Natur stets Bedürfnis ist. Wie frei fühlte sich nachher der Knabe, wie genoß er die Freude des Landlebens! Noch viel schöner, als mit den Dorfkindern zu spielen, welche alles nur nach seinem Willen thaten und nichts Neues wußten, war es mit Herrn Helbing. Der wußte stets etwas Neues, der war geschickter als er im Klettern und Turnen, im Schießen und Reiten, im Ballwerfen und Kegelschieben; der lehrte ihn fröhliche Lieder singen, Studentenlieder; der erweiterte seine Bekanntschaft mit Tieren, Pflanzen und Steinen. Im Herbst und Winter wechselten die Vergnügungen; die Eisdecke des See's war nicht mehr das unwillkommene Hemmnis für sein Schifflein, sie wurde ihm vielmehr zur Schlittschuhbahn, und wenn sie von solchem Vergnügen nach Hause kamen, blühten ihre Gesichter von Gesundheit. Im Frühlinge aber, als Strauch und Baum wieder im jungen Blätterschmucke glänzten, die Erde den warmen Odem aushauchte, die Blumen hervorschlüpften und Gottes Hand um die ganze Natur geschäftig war: da wurde ihr Gang durch den Wald oft gar feierlich und fromm, des Schöpfers Güte wurde in Raimunds Seele zur lebendigen Erkenntnis. Ja, er fühlte die Wahrheit des heiligen Spruches:
» Frage die Tiere, sie lehren es dich und die Vögel in der Luft, sie verkünden es dir; oder frage die Bäume des Feldes und die Fische des Meeres, sie erzählen es dir. Wer unter ihnen wüßte es nicht, daß Gottes Hand sie gemacht hat!«
Auf diese Weise entschwand die Zeit im gräflichen Schlosse. Zögling und Hofmeister liebten sich wie zwei Brüder verschiedenen Alters, und der »alte« Graf sah mit Freude auf seinen Sohn; er lohnte des Hofmeisters Werk mit Dank und Vertrauen.
Zwei Jahre waren auf diese Weise glücklich und voll des Segens entschwunden. Da wurde der Graf in die Hauptstadt berufen. Raimund und sein Erzieher blieben zurück und freuten sich nach dem Abschiede bereits auf das Wiedersehen. Es kam ihnen so öde in den weiten Gängen und Hallen des Schlosses vor, und auch die Unterthanen sehnten sich nach ihrem alten Herrn. Da hieß es immer wieder: »Wann kommt unser Graf zurück? es ist nichts ohne ihn! er fehlt uns überall!«
Es sollte anders gehen als sie hofften. Plötzlich blieben die fast täglichen Nachrichten vom Grafen aus; dann schrieb der Arzt, das herrschende Fieber hätte denselben ergriffen, und schon tags darauf, als Helbing mit Raimund ans Krankenlager eilen wollte, kam die Todesnachricht.
Der Graf hatte noch bis zum letzten Atemzuge des fernen Sohnes gedacht und mit zitternder Hand den folgenden Brief an Raimund geschrieben:
» Mein geliebter Sohn!
»Ich hoffte zuversichtlich, baldigst zu dir zurückzukehren. Gott fügt es anders; Sein heiliger Wille geschehe! Nur mein entseelter Leib zieht in die irdische Heimat, aber mein Geist zieht nach oben. Ich halte fest an dem Glauben, daß ich mit dir vereinigt bleibe im Geiste.
»Mein geliebtes Kind! Denke auch du an diese Vereinigung; denke, ich sei noch immer in deiner Nähe; befolge meine Lehren, als hörtest du sie fort und fort. Mit väterlichem Ernste verweise ich dich an deinen Erzieher; dessen Ermahnungen und Vorschriften sollen dir, als von mir kommend, gelten. Ich übergebe dich ihm noch einmal in diesem feierlichen Augenblicke. Alles, was deine fernere Erziehung betrifft, habe ich in rechtsgültiger Form schriftlich angeordnet.
»Ich kann nicht von hinnen scheiden, ohne dir noch ans Herz zu legen, was ich auf spätere Zeiten zu sagen vorbehielt. Unser altes Ahnengeschlecht hat seine Familienchronik wert gehalten, nicht nur durch Einzeichnungen von Ehren und Würden, sondern von edlen Thaten, von treuer Pflichterfüllung gegen die Unterthanen. Betrachte diese Familienchronik als deinen ›Ehrenspiegel‹ im echten Sinne des Wortes. Lies darin, aber nicht um eitlen Geistes deine Ahnenreihe zu zählen, sondern um von ihnen zu lernen, ein ›treuer Haushalter‹ zu werden. Liebe deine künftigen Unterthanen wie ein Vater seine Familie liebt; – hüte dich vor Hochmut, der das Auge verblendet und das Herz verhärtet. Lege diesen Brief auf das leere Blatt mit meinem Namen – es möge statt jeder Einzeichnung gelten.
»Und nun, mein teurer Sohn, lebe wohl! Ich lege im Geiste meine Hand auf dein junges Haupt und spreche den Segen über dich aus: Der Herr segne und behüte dich, er lasse Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! Er gebe dir Seinen Frieden! Amen.
» Dein treuer Vater.«
Helbing saß in des Grafen Zimmer, an seiner Brust ruhte der verwaiste Knabe, nachdem sie diesen Brief gelesen. Heftig strömten dessen Thränen, aber endlich schlief er an diesem treuen Herzen ein. Feierlich gelobte der Erzieher im Gebete, Vaterstelle an Raimund zu vertreten und des Grafen Vertrauen aufs vollkommenste zu rechtfertigen.
Endlich kam der Tag, wo der Sarg zur Vätergruft gebracht und eingesenkt wurde. Die Bevölkerung der ganzen Umgegend war herbeigeströmt, um dem Entschlafenen die letzte Ehre zu erweisen. Innige Blicke ruhten auf dem »jungen Herrn«, und alle Herzen waren ihm sogleich unterthan.
Des seligen Grafen letzter Wille wurde eröffnet. Derselbe ernannte für Raimund einen Vormund aus der Verwandtschaft, die Erziehung aber ward mit unbeschränkter Vollmacht bis zum 18. Lebensjahre Helbing übertragen und der Wunsch beigefügt, derselbe solle mit seinem Zöglinge in die Hauptstadt übersiedeln, woselbst für den heranwachsenden Knaben in öffentlichen Lehranstalten mehr Gelegenheit zur vielseitigen Ausbildung geboten war. Nur alljährlich, zur Ferienzeit, sollte Raimund in die Heimat zurückkehren, teils um in der Landluft körperlich zu erstarken, teils seinen künftigen Unterthanen nicht entfremdet zu werden.
So geschah es. Nach Verlauf von vier Wochen verließen die beiden unter einem herben Abschiede das Schloß, dessen nunmehr verödetes Aussehen mit den treuen Herzen der Unterthanen um den edlen Grafen zu trauern schien.
Ein anderes Leben beginnt für Raimund. Nicht mehr sind es die grünen Laubhallen des Waldes mit ihrem Lenz- und Sommerschmucke, die wogenden Aehrenfelder, die blumigen Wiesen, die Berge und Thäler der trauten Heimat, durch welche er in seinen Erholungsstunden dahin wandert; kein freundlich grüßendes Auge blickt ihm wohlwollend nach, er schreitet mit seinem Hofmeister, um das Freie zu suchen, durch lange Straßen, in welchen Hunderte von Fußgängern und rollende Wagen den Staub aufjagen, wo niemand ihn kennt, niemand ihn grüßt, niemand flüstert: »Gott segne ihn!« und wo, wenn der Zufall einen Bekannten vorüberführt, nur ein förmlicher Gruß gewechselt wird.
Anfangs fiel diese Veränderung dem jungen Grafen schmerzlich auf; besonders konnte er sich nicht in die steifen Formen finden und meinte, die Leute hätten alle kein Gefühl, bis Helbing ihm klar machte, daß im Verkehre unter so vielen Menschen, wo unmöglich persönliche Zuneigung herrschen könne, auch diese höfliche Form ihr Gutes habe.
Helbing führte Raimund zu den Freunden und Standesgenossen des seligen Grafen, denn alle erkundigten sich teilnehmend nach dem verwaisten Knaben. Hier ging diesem das junge Herz auf, denn er konnte von dem lieben, guten Vater sprechen und sah denselben noch im Grabe geachtet und verehrt. Nicht so heimisch wurde es ihm jedoch bei den jungen Grafen und Baronen; es kam ihm sonderbar vor, daß er denselben mit seinem vollen Titel und Namen vorgestellt ward. Die Bauernknaben standen ehedem lange nicht so schüchtern vor ihm, als er nunmehr vor diesen seinen Standes- und Altersgenossen stand. In größter Verlegenheit benahm er sich linkisch und unbeholfen, obgleich er sich sonst recht artig zu benehmen wußte. Auch deren Gespräche waren nicht nach seiner gewohnten Weise, er konnte nicht einstimmen, er fühlte sich fremd und war sichtlich erleichtert, als sein Hofmeister ihn wieder abholte. An diesem Abend kam es ihm zum erstenmale in der Stadtwohnung behaglich vor; es war ihm, als sei er aus der Fremde zur Heimat zurückgekehrt. Traulich saß er bei seinem lieben Helbing, horchte auf dessen Erzählungen, und als sie ihr Lager im gemeinsamen Zimmer suchten, geschah es unter heiterm Scherzen.
Die Freunde des verstorbenen Grafen hatten sich gütig gegen Raimund gezeigt und ihn aufgefordert, die Mußestunden mit ihren Kindern zu teilen. Helbing glaubte auch, dem Willen des Grafen zu folgen, wenn er seinen Sohn in diejenigen Kreise führte, für welche ihn Geburt und Vermögen bestimmt hatten. Er erkannte auch, daß die Zeit gekommen sei, wo derselbe zum Umgange Altersgenossen bedurfte, und daß es nicht gut sein würde, ihn davon auszuschließen. Eben, weil Helbing frei von Standesvorurteilen war, mußte er sich sagen, daß jeder Vater seine Kinder mit seinesgleichen zusammenbringe, der Arme mit Armen, der Reiche mit Reichen, warum also nicht auch der Adel mit dem Adel?
Raimund wiederholte also seine Besuche; allmählich lernte er auch die neuen Bekannten besser verstehen und fand gute, gescheite, wohlerzogene Knaben darunter, die nur bisher ein anderes Leben geführt hatten, als er. Sie sprachen eben von dem, was sie umgab, und da sie das Landleben nicht kannten, mußten sich beide Teile erst aneinander gewöhnen. Dies geschah schneller, als zu erwarten stand. Anfangs mußte Raimund manche Neckereien ertragen. Diese spornten ihn jedoch an, den jungen Herren zu zeigen, daß er nicht so linkisch und albern sei, wie dieselben meinten, und daß er so gut einen Edelmann abgeben werde, wie seine neuen Kameraden.
Raimund machte es sich hinfort zur Aufgabe, die feineren Stadt- und Salonmanieren zu lernen, ebenso rasch wie seine Freunde mit einer Antwort fertig zu sein und sich überhaupt keine Blöße mehr zu geben. Bald hatte er seine Vorbilder, bei denen keine Absichtlichkeit herrschte, sogar übertroffen. Daheim, bei seinem Hofmeister, erschien er jedoch unverändert; hier reizte ihn kein Gegensatz. Deshalb bemerkte jener auch keine Veränderung an Raimund. Anfangs war die bezeichnete Nachahmung diesem eine Last, er fühlte sich zu Hause davon befreit; allmählich aber ward sie zur Gewohnheit, welche dem Erzieher keineswegs tadelnswert erschien, bis ein geringer Vorfall ihn bedenklich machte.
In der Hauptstadt lebte Helbings Jugendfreund in bescheidenen Verhältnissen des untergeordneten Beamtenstandes. Dieser besaß einen wackern Knaben, der mit in Raimunds Klasse war und dadurch mit ihm bekannt wurde. Robert, so hieß der Knabe, kam eines Nachmittags zu Helbing, um einen väterlichen Auftrag auszurichten, und da Erzieher und Zögling sich eben auf den Spaziergang begaben, lud ersterer den Sohn seines Freundes dazu ein; er kannte Raimunds gute Meinung und Vorliebe für denselben, er hatte ihn öfters »den Musterknaben der Schule« genannt.
Es war verabredet, einen ländlichen Vergnügungsort zu besuchen, der auch bei Besitzern von Equipagen in Gunst stand. Als Raimund plötzlich dieses Umstands gedachte, wurde er purpurrot im Gesichte, schützte Kopfweh vor, um zu Hause bleiben zu können; aber Helbing fand darin gerade einen triftigen Grund, in frischer Luft sich Bewegung zu machen. Der junge Graf schritt stumm und übellaunig einher, war bald voraus, bald zurück und stellte allerlei naturgeschichtliche Untersuchungen an. So oft sich ein Wagengeräusch hören ließ, war er befangen und hielt sich dicht an Helbings Seite. Plötzlich bog um die Ecke der Straße die Equipage eines Grafen, zu dessen Söhnen Raimund am häufigsten kam. Der Graf, welcher selbst kutschierte, hielt die Pferde an und stellte an den Hofmeister die Frage, ob sein Zögling nicht mitfahren dürfe. – Helbing dankte jedoch höflich und fügte – indem er auf Robert zeigte – bei, daß sie heute einen kleinen Gast hätten.
Raimunds Wangen glühten in Scham; er wollte schon sagen: »Es ist nicht mein Gast!« aber der Graf lächelte freundlich dem schüchternen Robert entgegen, den er als den besten Klassenschüler erkannte, da sein Anselm ebenfalls die Anstalt besuchte, grüßte zum Abschiede, und fort rollte der Wagen.
Helbing hatte seinen Zögling plötzlich durchschaut. Lange, wie im Vorwurfe, ruhte sein Auge auf dem Knaben. Solchen Blick konnte Raimund nicht aushalten, er senkte die Augenlider; aber in seinem Innern kochte es fort und fort, und während sie schweigend dahinschritten, zog zum erstenmal ein haderndes Gefühl gegen den treuen väterlichen Freund in die junge Seele.
Von diesem Tage an beobachtete Helbing seinen Zögling unablässig und kam zur betrübenden Bestätigung seiner Wahrnehmung. Ja, der junge Graf war hochmütig geworden, er hatte sich des Umgangs mit Robert geschämt! Doch verzagte Helbing nicht; er baute auf Raimunds treffliches Gemüt und hoffte alles von der Ferienzeit in der alten, lieben Heimat. Endlich war dieser Zeitpunkt gekommen; fröhlich packte Helbing den Koffer und nach einigen Stunden rollte der Wagen über das Pflaster und dem väterlichen Erbe zu.
Gemischte Gefühle zogen durch Raimunds junge Brust, als er sich nach Verlauf nahezu eines Jahres, das ihm so unendlich viel Veränderung gebracht hatte, wieder der Heimat näherte. Dort befand sich des Vaters teures Grab; dort brachte jedes Plätzchen eine wehmütige Erinnerung an denselben; dort hatte er eine glückliche Kindheit verlebt: – aber, dort war er nun auch der Herr, zwar jetzt nur ein fünfzehnjähriger Knabe, für welchen andere die Herrschaft ausübten, doch der künftige Herr und Erbe. Darüber hatte er bereits nachgedacht, und es hatte seine junge Brust mit Stolz gehoben. Mit den unreifen Gedanken eines Knaben malte er sich seinen künftigen Beruf aus. Er wollte unendlich Großes vollbringen, davon sollte dereinst die Familienchronik viel zu berichten haben. Er kam sich jetzt schon hochwichtig vor und hatte eine ganz seltsame Ansicht von seiner »Herrenwürde«. Vor allem beschäftigte ihn der Gedanke, wie er dieselbe aufrechtzuerhalten und sich bei den Unterthanen in Respekt zu setzen habe. Oft überflog dabei sein Angesicht ein brennendes Rot, wenn er an die ehemalige Vertraulichkeit mit den alten Dienern und sogar den Dorfleuten dachte.
Im gräflichen Schlosse war inzwischen eine große Veränderung vorgegangen. Es glich fast einem Invalidenhause; die jüngeren Diener waren entlassen worden und nur die alten, im Dienste ergrauten, verblieben für ihre Lebzeit. Damit war zugleich Sorge getragen, daß sich Raimund bei seinen alljährlichen Besuchen daselbst heimisch und behaglich fühlen konnte.
Helbing hatte dem treuen Lukas, des Grafen Leibjäger, den Tag ihrer Ankunft gemeldet. Da zog Freude durch den ganzen Ort, die größte Rührigkeit herrschte im Schlosse. Die alte Gertrud setzte Speisekammer und Küche in guten Zustand; Konrad lüftete die Zimmer und entkleidete die Möbel ihrer weißen Ueberzüge. Lukas war überall; die Ackerpferde wurden gestriegelt, auch ein paar Reitpferde erwiesen sich noch tauglich für den jungen Grafen und dessen Hofmeister. Eine Woche lang kamen bei Feierabend die Leute in den Schloßhof, um sich an den Vorbereitungen ein wenig durch Mitfreude zu beteiligen und an einer Triumphpforte zu flechten. Am Tage der Ankunft hatte der Schullehrer den Kindern Vakanz gegeben, und weil man die Stunde des Eintreffens nicht genau wußte, scharten sich alt und jung bereits nach dem Mittagessen im Schloßhofe. Endlich erscholl die Kirchenglocke zu ganz ungewöhnlicher Zeit. Man hatte vom Turme aus den heranrollenden Wagen bemerkt, und hastig und lustig wurde von den Knaben der Glockenstrang zur Begrüßung ihres »jungen Grafen« gezogen. Die Kinder bildeten auf beiden Seiten Spaliere, die Erwachsenen standen mit entblößten Häuptern, wohl auch mit gefalteten Händen in zweiter Reihe, manches Auge floß über im Andenken des Verstorbenen: da rollte der Wagen in den Hof, ein lautes »Hoch!« füllte die Luft, und mit von Freude zitternden Händen öffnete der alte Lukas den Wagenschlag. Unter der blumenbekränzten Thüre stand die alte Gertrud; kaum trugen sie die Füße. Lukas hatte sogar Hektor und Juno von der Kette losgelassen; sie brachten bellend und wedelnd ihr Willkommen. Raimund neigte sich zu ihnen und streichelte sie; dann schaute er sich von dem obern Treppenabsatze des Schloßthores um, grüßte mit dem schönen Lockenhaupte nach allen Seiten und sprach mit lauter Stimme: »Schönen Dank, ihr guten Leute, für den Empfang!« und eilte dann, ohne nach rechts oder links zu blicken, die wohlbekannte Treppe zu seinen Zimmern hinauf.
Traurig sahen ihm die alten Diener nach; Helbing aber schüttelte jedem die Hand und suchte sie durch eifrige Fragen und Begrüßungen von ihrer Enttäuschung abzulenken.
Eine Woche war seit diesem Tage entschwunden. Raimund hatte mit Helbing verschiedene Ausflüge in die Nachbarschaft gemacht, Einkehr bei alten Bekannten gehalten, allerlei besichtigt und sich im Thal, auf dem Fluß, im Wald und auf Höhen herumgetummelt. Er betrug sich äußerst höflich gegen alle Leute und war mit sich in hohem Grade zufrieden, denn er hatte, wie er glaubte, es taktvoll verstanden, freundlich und gnädig zu sein und dabei doch die Leute in gebührenden Schranken zu halten. Ja, er war mit sich zufrieden, der »junge Herrscher«, – aber keine Seele war es mit ihm! Es lag für die guten Leute etwas gar Fremdes, Sonderbares in Raimunds Art und Weise, etwas so Verschiedenes von ehedem, oder von dem »seligen Grafen«. Wenn er sich nach einem Besuche entfernt hatte, sprachen die Landleute untereinander: »Was für ein gar feines Herrlein doch unser junger Graf geworden ist!« – Dann fügten sie mit einem Seufzer bei: »Aber der alte Herr steht nimmer auf! einen zweiten gleich ihm gibt's nimmer auf der Welt. Gott hab ihn selig!«
Im Schlosse gestaltete es sich nicht besser, als beim Einzuge. Raimund vermied ängstlich jede vertrauliche Annäherung der alten Diener, sprach mit ihnen nur das Nötigste, bedurfte gar wenig Bedienung, sprang Treppe auf und ab, ohne eines von ihnen zu beachten, und in der Küche, woselbst ehedem sein liebes Kindergesicht im Widerschein des Herdfeuers so oft geglänzt hatte, war er noch nicht ein einziges Mal gewesen, obwohl die alte Gertrud alle seine Lieblingsspeisen der Reihe nach kochte. In diesen Tagen starb den Leuten, sozusagen, der alte Herr noch einmal, und mancher schlich sich auf dessen Grab, um sich auszuweinen. Gesprochen wurde darüber nichts; aber Helbing las in den Mienen einen stillen Vorwurf, den er doch so ganz und gar nicht verdient hatte.
Das anfänglich schöne Herbstwetter schlug in Regen und Nebel um, und die Spaziergänge mußten eingestellt werden. Raimund hielt sich nun fast beständig in der Bibliothek oder im Ahnensaal auf, wo die lebensgroßen Bilder seiner Vorfahren düster herabschauten in ihrer altersdunklen Farbe. Er hatte sich in die Familienchronik vertieft und suchte nunmehr mit seinen Ahnen Bekanntschaft zu machen durch Vergleichung der Einzeichnungen mit den Bildern. Auch die Weltgeschichte mußte ergänzend dazu helfen; denn so mancher seiner Ahnherren war mit den Kaisern in den Krieg gezogen, oder hatte ein hohes Reichsamt bekleidet, oder irgend eine wichtige Gesandtschaft übernommen. Ihre Namen reichten weit in die Jahrhunderte zurück, immer angesehen, immer einflußreich, und Raimunds Herz pochte heftig in befriedigtem Stolze. Ja, er entwarf schon ehrgeizige Pläne für sich und sah schon sein eigenes Blatt darin mit hohen Ehren beschrieben.
Helbing war mit diesem eifrigen Studium keineswegs zufrieden. Er suchte seinen Zögling durch verschiedene Vorschläge von Spazierfahrten und Ritten hiervon abzulenken. Vergebens! Der junge Graf wollte nur lesen, nur studieren und saß stundenlang, mit glühenden Wangen über die Familienchronik gebeugt. Als einmal der Himmel sich aufheiterte, forderte der Hofmeister den Lesenden auf, doch einmal die alten Geschichten ruhen zu lassen und dagegen im Buche des Schöpfers zu lesen.
Da erhob Raimund sein erglühtes Gesicht und entgegnete gereizt: »Was hat Ihnen dies Buch gethan, daß Sie stets dagegen zu Felde ziehen? Wer eine alte Familiengeschichte besitzt, soll sie gründlich studieren, und es war dies auch der Wille meines Vaters.«
Ruhig antwortete Helbing: »Studieren und beherzigen.«
Hastig rief nun der Knabe: »Was soll das heißen, Herr Helbing? Beherzige ich sie etwa nicht?«
Mit unendlicher Liebe im Tone sagte der Hofmeister: » Recht beherzigen, lieber Raimund, nicht in verkehrter Weise, wie du. Beherzigen, wie leutselig, wohlwollend, teilnehmend, freundlich deine Ahnen gegen ihre Untergebenen waren, wie sie dieselben als Angehörige betrachteten. Heißt es etwa diese Lehren beherzigen, wenn man treue Diener durch Nichtbeachtung, Unfreundlichkeit und hochmütiges Wesen kränkt, daß den alten Herzen weh und bange wird und ihnen die Thränen in die Augen treten? Schäme dich, Knabe, daß du aus der ehrwürdigen Familienchronik nur Gift, statt Honig ziehest!«
Helbing hatte diese Schlußworte mit vor Schmerz bebender Stimme gesprochen, denn alle bisherigen, leise angedeuteten Ermahnungen waren unverstanden geblieben. Doch Raimunds Herzensboden zeigte im gegenwärtigen Augenblicke dafür keine Empfänglichkeit. Im höchsten Grade gereizt sprang er auf und rief:
»Knabe und immer Knabe! Warum nicht auch noch ›Kind‹? Wann wird die Zeit kommen, wo Sie einsehen, daß man nicht immer ein Knabe bleibt! Freilich, bei solchem Vorbilde werden auch die Diener niemals lernen, daß ich kein Kind mehr bin, wo mich jeder Bauernjunge dutzte und sich mir nahte. Ich bin dieser Behandlung satt, völlig satt!«
Raimund hielt, von seinen eigenen Worten betroffen, inne und schaute mit scheuem Blicke verstohlen auf seinen Hofmeister. Er begegnete einem wehmütigen, vorwurfsvollen Ausdrucke, als wollte er sagen:
»Das mir, deinem Erzieher, deinem Freunde?« – Aber kein Wort kam von Helbings Lippen. Diesen Anblick konnte Raimund nicht ertragen; ein glühendes Rot überzog von neuem sein Angesicht, und er senkte beschämt die Augen. Als er sie wieder erhob, war die Stelle, wo Helbing gestanden, leer. Angstvoll durchschritt der junge Graf die Bibliothek, dann trieb es ihn fort in ihr gemeinsames Zimmer. Helbing war auch dort nicht, und wo er denselben suchte, nirgends fand sich eine Spur von dem schwer gekränkten Freunde.
Ruhelos war Raimund lange im Garten und Felde umhergestreift. Sein Herz verurteilte ihn, er fand nirgends Rast; die strafenden Blicke seines Lehrers verfolgten jeden Gedanken. Fest drückte er die Hand auf die Augenlider; aber dennoch sah er den wehmütig strafenden Blick. Sein Herz sehnte sich nach dem treuen Begleiter; er suchte ihn überall; wenn aber in der Ferne ein gedämpfter Tritt erklang, so fürchtete er sich vor der Begegnung, verbarg sich wo möglich hinter einem Baume oder Gebüsche, und atmete erst wieder auf, als der Ton verhallt war, oder er sich überzeugt hatte, daß es nicht Helbing sei. Bereits waren zwei Stunden verflossen, seitdem er einsam umherstreifte, zum erstenmal in seinem Leben einsam, und immer unerträglicher, vorwurfsvoller ward ihm diese Einsamkeit.
Endlich brach die Dämmerung herein, und mit laut pochendem Herzen lenkte der junge Graf seine Schritte durch den Schloßhof, wo Lukas auf einem Bänkchen saß und ehrerbietig, aber schweigend sich erhob. Für sein Leben gern hätte Raimund nach Helbing gefragt, aber er scheute sich, es nun zu thun und ärgerte sich, daß Lukas nicht von selbst Auskunft erteilte. Raimund eilte die Treppe hinauf, langte bei seinem Zimmer an; dort stand Konrad und öffnete seinem jungen Gebieter die Thüre mit tiefer Verbeugung.
Aber welche Verwirrung ergriff den Heimkehrenden, als er umherschaute und im Schlafkabinet den Hut ablegte! Es befand sich nur noch ein einziges Bett darin, Helbing hatte das seinige entfernen und, wie Raimund sogleich erriet, in das daranstoßende Zimmer bringen lassen.
Nun war es für den jungen Grafen, als ob plötzlich der Vorhang aufgerollt würde; er übersah die ganze Veränderung. Die einsam verlebten Stunden hatten seine Erkenntnis geweckt. Diese sprach zu ihm: »Du verschmähtest die zutrauliche Begegnung der alten Diener, du lehntest dich sogar auf gegen die väterliche Anrede deines Hofmeisters; du wolltest dem Knabenalter entwachsen sein: da hast du es! – Was soll ich nun thun? Wie kann ich es gut machen? Wird mir Herr Helbing verzeihen? – Nein, ich habe ihn zu sehr gekränkt, er wird, er kann nicht vergeben! Niemand wird mich mehr lieben!«
Inzwischen war es fast dunkel geworden. Nun regte es sich im dritten Zimmer. Raimund hielt lauschend den Atem an; es schellte. Gleich darauf brachte Konrad die Lampe und Helbing trat ebenfalls in das Zimmer. Er grüßte höflich und sprach darauf:
»Wollen Sie zu Tische kommen, Graf Raimund? Der Diener hat soeben gemeldet, daß alles bereit sei.«
»Wollen Sie zu Tische kommen?« – Dieses kleine Wörtchen brannte in Raimunds Seele.
»Sie«, nicht mehr »Du«! O, wie weh, wie unendlich weh ihm dieses that! Mechanisch folgte er seinem Hofmeister ins Speisezimmer. Man setzte sich; es herrschte eine lautlose Stille, Konrad stand hinter des Grafen Stuhle und servierte die Speisen. Endlich begann Helbing eine gleichgültige Rede, aber seine Stimme klang fremd und kalt; es war wohl für beide Teile eine Erleichterung, als man sich wieder in das Studierzimmer begab.
Die darauf folgende Stunde verfloß bei der gewöhnlichen Beschäftigung. Helbing schlug das Buch auf, in welchem er nach dem Abendessen vorzulesen pflegte; aber Raimund hörte es kaum, er vernahm nur die unsäglichen Vorwürfe seines Herzens. Immer drängte es ihn, den Lesenden zu unterbrechen, reumütig die Arme um ihn zu schlingen, ihn zu bitten, wieder der Alte zu sein; aber der Stolz des Knaben bannte ihn auf den Stuhl und verschloß ihm die Lippen; er hieß ihn ein versöhnendes, wenigstens einleitendes Wort des Hofmeisters abwarten.
Jetzt kam die Stunde des Schlafengehens. Raimund zögerte, wartete auf dieses Wort; aber er wartete vergebens darauf. Nun sagte er leise »gute Nacht« und schlich sich nach Helbings einfacher Erwiderung in sein Zimmer, kleidete sich aus, sank ermüdet ins Bett, löschte das Licht und hoffte im tiefen Schlummer Vergessenheit zu finden. Aber der Schlaf senkte sich nicht auf seine Augenlider; er mußte unverrückt auf den matten Lichtschimmer aus Helbings Zimmer blicken. Nicht das Licht störte seine Ruhe, sondern der Gedanke an denjenigen, welcher beim Lampenscheine wachte und ihm zürnte. Eine Stunde, zwei Stunden waren dahingeschlichen; immer sah er den blassen Schein, immer horchte er auf das leiseste Geräusch, vielleicht durch das Umwenden eines Blattes verursacht; aber kein Lebenszeichen drang an sein lauschendes Ohr; diese Stille vermehrte noch Raimunds Beklemmung, er mußte immer denken, daß sie einer Totenstille gleiche, daß neben dem Sarge des Vaters, neben diesem ewig Schlummernden auch die Lichter gebrannt hatten.
Endlich war seine Qual durch diese Vorstellung aufs höchste gestiegen; ein paarmal fühlte er sich versucht, aus dem Bette zu springen und hinein zu eilen; aber die Furcht des Schuldigen hielt ihn zurück. Jetzt griff er nach dem Feuerzeuge und zündete sein eigenes Licht an in der schüchternen Hoffnung, Helbings Besorgnisse zu erwecken, damit derselbe zu ihm eile, wie er so oftmals gethan.
Vergebens! nichts regte sich im anstoßenden Gemache, nur der unheimliche Schimmer leuchtete fort und fort. Da schlich Raimund aus dem Bette, um sich ein Buch zu holen, nur um seine Gedanken in Schlaf zu wiegen. Er nahte sich den Bücherregalen, griff fast bewußtlos nach seiner teuren Familienchronik und kehrte auf sein Lager zurück. Die schweren Deckel des Einbandes fielen auseinander, das Buch öffnete sich bei der Einlage, wie so oftmals zuvor und Raimund erblickte den letzten Brief seines Vaters. Ein Jahr lang hatte er ohne Beachtung dort gelegen, die Geschichte der Ahnen hatte den jungen Geist so ganz gefesselt, daß derselbe nicht loskam von den alten Blättern. Jetzt aber redeten des Vaters Schriftzüge gleich einer Geisterstimme an sein schuldiges Herz. Er mußte sie hören, er konnte ihr nicht ausweichen. Und Raimund las die letzten Worte seines Vaters mit immer steigender Bewegung. Als er zu den Worten des Briefes kam: »Mit väterlichem Ernste verweise ich dich an deinen Erzieher. Dessen Ermahnungen und Vorschriften sollen dir, als von mir kommend, gelten. Ich übergebe dich ihm noch einmal in diesem feierlichen Augenblicke«: da flossen seine heißen Thränen nieder auf die Handschrift; aber er las weiter und weiter – und nun klang es von des Vaters Munde: »Hüte dich vor Hochmut, der das Auge verblendet und das Herz verhärtet!«
Da konnte Raimund sich nicht mehr halten, – er sprang aus dem Bette, warf sich in seine Kleider mit zitternder Hast und eilte in das Nebengemach. Dort am Tische saß Helbing, wie er ihn verlassen, vor seiner Lampe, das Haupt in die Hand gestützt. Als aber der Laut eines Schrittes an des Bekümmerten Ohr traf, als er den Knaben erblickte – streckte er ihm wortlos beide Arme entgegen. Mit einem Schrei des Schmerzes und der Rührung eilte Raimund in dieselben, schluchzte an der treuen Brust, die soviel Liebe für ihn barg, und konnte nichts hervorbringen als »Verzeihung, Verzeihung«!
Aber mehr Worte waren auch gar nicht nötig! Alles war wieder gut, o, viel, viel besser, als je zuvor. In dieser Nacht ruhte Raimund an Helbings Seite und entschlief an dessen Brust, wie ein weinendes Kind am Mutterherzen. Als die Sonne wieder durch das Fenster lächelte und des Knaben Augen erschloß, da begegneten sie den liebestrahlenden Blicken seines väterlichen Freundes. Das war ein seliges Erwachen, so frisch, wie der Tag, dem auch viele bewölkten Tage vorangegangen waren.
Nun erst hielt Raimund seine eigentliche Heimkehr ins Vaterhaus. Der Geist inniger Liebe wehte durch alle Räume; die schlichten Herzen verspürten augenblicklich die eingetretene Veränderung und die Leute sagten: »Er ist das leibhafte Ebenbild unsers alten Herrn! Schade, daß er nicht auch Fritz heißt!«
Am Morgen dieses Tages gingen Lehrer und Zögling Arm in Arm dem Friedhofe zu. Dort, an des alten Grafen Schlummerstätte legte Raimund das heilige Gelübde ab: »des Vaters letzte Worte sein lebenlang zu befolgen, die Familienchronik in Wort und That zu ehren«; – und er hält es unverbrüchlich auch sein lebenlang.